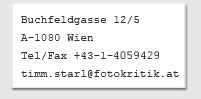Timm Starl
Postkarten und Avantgarde
Clément Chéroux, Ute Eskildsen
Frankierte Fantastereien
Das Spielerische der Fotografie im Medium der Postkarte
Aus den Postkartensammlungen Gérard Lévy, Peter Weiss
Ausstellungskatalog Fotomuseum Winterthur, Jeu de Paume, Paris, Museum Folkwang, Essen
Göttingen: Steidl, 2007
30,1 : 30,2 cm, 215 (+1) S., 345 Abb. in Farbe
Gebunden, Schutzumschlag
€ 40,-, SFR 63,-
„Seit etwa zwanzig Jahren bemüht sich die Kunstgeschichte verstärkt darum, die Beziehungen der Künstler des 20. Jahrhunderts zur Populärkultur besser zu verstehen.“ Den Rückblick ergänzt Clément Chéroux um einige Ausstellungen und Publikationen, die in den vergangenen Jahrzehnten in den USA und Frankreich erschienen sind. All die Kuratoren und Publizisten fahndeten nach „Elementen, die üblicherweise nicht dem Bereich der Kunst zugeordnet werden“ (200) und der Avantgarde als Anregungen gedient hätten. Dieser Suche nach stilistischen oder motivischen Vorbildern gehört eigentlich zu den Lieblingsbeschäftigungen des Faches, wenn nicht gerade ein Genie zur Begutachtung ansteht, dem ausschließlich originäre Einfälle attestiert werden. Insofern ist es verdienstvoll, wenn sich Chéroux aufmacht und die Postkartenproduktion durchforstet nach Hervorbringungen, die auf irgendeine Weise Einfluss auf die Arbeiten von Duchamp, Man Ray, Hannah Höch und anderen Größen ausgeübt haben könnten. Damit erfahren manche Leistungen von Künstlern eine Relativierung, indem sie aus dem Schwebezustand der Einmaligkeit befreit und auf ein historisches Fundament gestellt werden. Und der Postkarte käme endlich insofern Beachtung zu, als einige ihrer Werke als relevant für die Bildgeschichte der Fotografie, Fotomontage und Collage angesehen werden.
So weit, so gut! Doch Chéroux schreibt den „fantastischen Welten [...] des populären Bildes“ (197) auf Postkarten teilweise eine Rolle zu, die ihnen nicht angemessen ist. Denn nicht wenige „Fantastereien“ sind älteren Datums und nicht erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Karten in den Maßen 14 x 9 cm in Umlauf gekommen. Kuriose Montagen, Geisterbilder und Doppelgängerporträts sowie Vignettierungen hat es schon auf Cartes de visite der 1860er Jahre gegeben. Personendarstellungen als Skulpturen und Büsten kennt man auf Cabinetbildern der 1890er Jahre. Mit anamorphotischen Deformationen hat bereits Louis Ducos du Hauron 1889 gearbeitet. Bemalte Kulissen mit Ausschnitten für die Gesichter waren bereits in manchen Ferrotypie-Buden auf Jahrmärkten und Ausflugszielen vor der Jahrhundertwende in Gebrauch. Was jedenfalls die Skala der Sujets angeht, haben die wenigsten ihre erstmalige Wiedergabe auf Postkarten gefunden, auch wenn diese zur deren Popularisierung beigetragen haben.
Chéroux teilt die Bildpostkarten in drei Gruppen je nach ihren Herstellern: Verlage, kleine Studios, Amateure. Eine solche Struktur ist wenig aufschlussreich, zumal Amateure vor wie nach 1900 vielfach denselben Praktiken wie die Atelierfotografen nachgegangen sind, insbesondere was Doppelbelichtungen und Doppelgängerbildnisse anlangt. Die entsprechende Anleitungsliteratur – wie beispielsweise das Photographische Unterhaltungsbuch von Alfred Parzer-Mühlbacher, zuerst erschienen 1905 – wendete sich ebenso an professionelle Lichtbildner wie an Dilettanten. Zudem traten noch andere Hersteller von Postkarten auf den Plan: Firmen verlegten Werbekarten, Operettenspielstätten beauftragten Fotografen, die Ansichten des Gebäudes, eines auftretenden Sängers samt dem Refrain eines bekannten Liedes und andere Mitwirkende zu einer Collage zu vereinigen, die als Postkarte vervielfältigt und vom Auftraggeber vertrieben wurde.
|