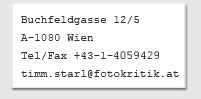Nun wandelt sich die Kundschaft, die nicht mehr nach Passfotos verlangt, sondern „Spassfotos“ (83) haben möchte und sich mit schwarzweißen Wiedergaben begnügt. Für Jugendliche bilden die Automaten Treffpunkte, an denen man sich verabredet, um Verliebtheit und Freundschaften bildlich zu dokumentieren. Man posiert allein oder zu zweit, schneidet Grimassen oder schmiegt sich aneinander, tauscht die Plätze, wechselt zwischen zwei Blitzen Haltung und Miene oder auch den Partner, die Partnerin. „[D]as Fotografieren beim Fotoautomaten ist das Ereignis selbst.“ (88). Die Bilder werden verschenkt, getauscht und gesammelt, und so manche bewahren 300 Exemplare in ihrer Kollektion.
In den 1990er Jahren interessieren sich zunehmend Zeitungen und Magazine für diese Rituale der Jugendkultur, Künstler verwenden Selbstbildnisse für ihre Arbeiten. Mit dem Aufkommen der digitalen Fotografie zeichnet sich um 2000 das Ende der Firma ab, auch haben die Brüder Balke inzwischen das Pensionsalter erreicht. Sie erhalten das Angebot eines Konkurrenten, der nicht an den Apparaten, sondern an den Standplätzen interessiert ist, und nehmen es an. 2007 werden die beiden letzten Automaten demontiert.
Interessant an dem Werdegang der Schnellphoto AG ist der sich wandelnde Gebrauch eines Automaten, und an der Publikation gefallen die Art, wie das Dasein eines Unternehmens von allen Seiten beleuchtet wird, und eine Gestaltung, die das vielfältige Bild- und Textmaterial anschaulich macht. Die Illustrationen zeigen die Besitzer der Firma und die Nutzer der Automaten, das Büro und die Werkstätte, Konstruktionszeichnungen und Einzelteile aus dem „Innenleben“ der Maschine, das Chemielabor und Rezepturen, Presseartikel, Korrespondenzen mit Behörden und Beschwerdebriefe von Kunden, den Abbau eines Geräts und die Nachrufe der örtlichen Blätter. In die Chronologie der Firmengeschichte sind zudem immer wieder Gespräche mit den Balkes und dem ältesten Mitarbeiter eingestreut. Ein Beitrag von Nora Mathys untersucht auf der Basis von sechs Interviews mit Jugendlichen deren Disposition und Praktiken im Umgang mit den Fotografien. Der fotohistorische Abriss der Herausgeberin zur Porträtfotografie und den Selbstbildautomaten enthält einige wenige Ungenauigkeiten und seltsame Einschätzungen bis hin zu der Feststellung: „Den digitalen Bilddaten gehört die Zukunft, den analogen die Vergangenheit.“ (156).
Man sollte diesen etwas misslungenen Rückgriff jedoch nicht allzu hoch werten. Was entscheidend zählt, ist das Vorliegen eines inhaltsreichen Buchbeitrages zu einem bislang wenig beachteten Thema und dessen vielschichtigen Ebenen: das Automatenbild als das Ergebnis eines fotografischen Aktes, bei dem Autor/en und Modell/e in eins fallen; als ein Mittel der Selbstvergewisserung und Vergegenwärtigung im und als Bild; als eine Wiedergabe, die aus dem Blick in den Spiegel resultiert; als Teil eines Vorganges, der zu Verfremdungen und Stilisierungen, zu Rollenspielen und Maskierungen einlädt.
Was der Publikation neben allem anderen einen zusätzlichen Reiz verleiht, ist die liebevolle Aufmerksamkeit, mit der Irene Stutz die Protagonisten vor und hinter der Kamera bedenkt und die uns damit einen ungewöhnlichen Nachruf auf eine fotografische Institution und eine alltagskulturelle Praxis beschert hat. Es stimmt auch nicht traurig, wenn am Ende Bilder der Demontage auftauchen, denn einer der letzten Apparate bricht gewissermaßen zu neuen Ufern auf: „Als Vertreter einer aussterbenden Gattung steht einem der Automaten allerdings eine anstrengende Tournee bevor. Zuerst soll der Automat im Raum Bern bei einer Hochzeit als Attraktion dienen, soll ein letztes Mal Momente, einen ganz besonderen Tag sogar, für 50, 100 Jahre auf Papier bannen – durchaus ein würdiges Ende für einen ‘Photoautomaten'. Danach transportieren ihn die Balkes nach Zürich, wo er an der Vernissage des vorliegendes Buches zum Einsatz kommt. Schließlich fahren ihn die Balkes zurück nach Bern, wo er im Museum für Kommunikation künftig stummes Zeugnis ein vergangenen Ära ablegen wird.“ (180).
Die Abbildungen sind Wiedergaben aus dem besprochenen Band. Januar 2008
................................................................................................................................................................
© Timm Starl 2008
PDF - 182kb
nach oben
|